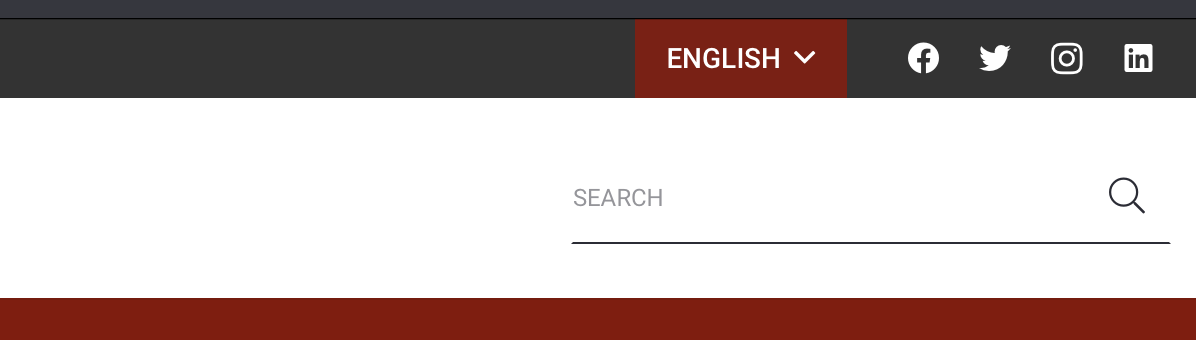GUTACHTEN
Weibliche Genitalverstümmelungen sind heute nicht nur in einigen geografischen Gebieten des Planeten, in denen sie traditionell weit verbreitet sind, sondern auch in scheinbar unerwarteten Kontexten ein bedeutendes Problem.
Tatsächlich haben die Migrationsströme, die von Gemeinschaften ausgehen, die historisch weibliche Genitalverstümmelung praktizieren, im Kontext des massiven Globalisierungsprozesses die Wahrscheinlichkeit geschaffen, diesen kulturellen/religiösen Praktiken auch in Ländern zu begegnen, in denen sie zuvor nicht beobachtet oder beschrieben wurden.
Dieses Ereignis hat eine starke Reaktion hervorgerufen, um die Fortsetzung des Brauchs weiblicher Genitalverstümmelungen in kulturell für diese Praxis anfälligen Migrantenpopulationen zu verhindern, insbesondere in europäischen Ländern mit multiethnischen und multikulturellen sozialen Strukturen.
Die gesetzgeberische Antwort hat einen parallelen Weg zur sozialen und kulturellen Reaktion in Richtung der Begrenzung dieser Praktiken eingeschlagen und schwankt zwischen stark repressiven Normen des Phänomens und Versuchen der Vermittlung zwischen Tradition und individuellen Rechten.
Insbesondere die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat weibliche Genitalverstümmelungen als Verletzung der Menschenrechte und des Rechts auf Gesundheit, als extreme Form der Diskriminierung und Folter entschieden verurteilt. In ähnlicher Weise hat beispielsweise die britische Gesetzgebung weibliche Genitalverstümmelungen im Vereinigten Königreich als illegal definiert und verlangt, dass Gesundheits- und Sozialfachkräfte solche Praktiken melden.
Im Umfeld von Migrantenpopulationen stellte dieser Ansatz jedoch nicht immer ein wirksames Abschreckungsmittel dar, um die Praxis weiblicher Genitalverstümmelungen zu reduzieren oder zu beseitigen. Tatsächlich haben mehrere Studien gezeigt, dass Migranten aus Ländern, in denen weibliche Genitalverstümmelungen als „normal“ angesehen wurden, ihre Meinung über diese Praxis trotz längerer Kontakte mit nicht akzeptierenden Kontexten und der Integration in Gesellschaften, in denen die Praxis verurteilt wurde, nicht änderten.
Im Bewusstsein der Schwierigkeit, atavistische Praktiken nur durch das Verbot auszurotten, wurden alternative Herangehensweisen an das Problem vorgeschlagen, wie zum Beispiel ein nicht wertender transkultureller Kontakt, der auf Dialog und Menschenrechten basiert. Alternativ wurden gemeindebasierte „Selbsthilfegruppen“ vorgeschlagen, um den sozialen Fortschritt zu diesem Thema durch kulturell angemessene Informationen zu katalysieren.
Gleichzeitig hat die fortschreitende Änderung der Gesetzgebung einiger afrikanischer Länder in Bezug auf traditionelle Arzneimittel, die als integraler Bestandteil des Rechts auf Gesundheit anerkannt sind, unvorhersehbare Szenarien auch in Bezug auf traditionelle religiöse und kulturelle Praktiken eröffnet.
Schließlich hat der Prozess der kulturellen und rechtlichen Neudefinition von Geschlechtsidentitäten, der in vielen westlichen Gesellschaften im Gange ist, die Notwendigkeit einer tiefgreifenden Reflexion und eines erneuten Lesens des Themas, das sich nicht mehr auf den rein weiblichen Bereich beschränkt, weiter hervorgehoben.
In diesem Zusammenhang ist das Management der weiblichen Genitalverstümmelung in Migrantenpopulationen ein sehr anspruchsvolles Thema im Bereich der Grenzmedizin. Insbesondere der regulatorische Kontext kollidiert oft mit Hunderten von Jahren alten Traditionen und mit sozialen Systemen, die schwer zu ändern sind, insbesondere bei der Ankunft im Zielland des Migrationsprojekts. Der Nachweis weiblicher Genitalverstümmelungen ist stark auf die Ankunft von Migrantinnen beschränkt, wenn man bedenkt, dass es oft nicht von Frauen zum medizinischen Interview gemeldet wird und dass es möglich ist, das Problem nur mit einer gynäkologischen Untersuchung herauszuarbeiten. Die Auswirkungen weiblicher Genitalverstümmelungen auf die psychische und psychische Gesundheit werden auch durch die Verwendung von Bewertungskategorien belastet, die auf westliche Systeme kalibriert sind.
Das wesentliche Problem in der Grenzmedizin ist die Tatsache, dass alles schnell geschieht und an der Schnittstelle zwischen zwei oft nicht harmonischen Lebensvisionen stattfindet: der des Mutterlandes und der des Migrationslandes. Soziale und kulturelle Modelle, die Repräsentation von Gesundheit und Krankheit haben oft einen starken Einfluss auf einzelne Geschichten und begraben sie unter den Traditionen der Menschen, denen der Migrant angehört.
In diesem Zusammenhang besteht das vorrangige Problem nicht darin, wie man auf weibliche Genitalverstümmelungen reagiert, sondern wie man das Problem hervorhebt, wie man diejenigen einbezieht, die Träger dieser Läsionen sind, wie man ihnen mögliche Lösungen auf effektive, aber auch nicht wertende Weise anbietet.
Grenzmedizin ist eine noch nuancierte und nicht klar definierte Disziplin, die sich aber für einen der aktuellsten Momente des Migrationsprojekts interessiert: die Wechselwirkung zwischen der Medizin des Ankunftslandes und den Bedürfnissen der Migranten. Ihre Mission ist die richtige Antwort auf die Bedürfnisse einer Person, die aus einem anderen sozialen, kulturellen und epidemiologischen System kommt. Diese Reaktion ist nur dann ausreichend, wenn sie sich trotz der kulturellen Unterschiede zwischen Anbieter und Nutzniesser in einer effektiven Gesundheitsschutzbeziehung und einem Bündnis mit dem Patienten niederschlägt.
Die aufgetretenen Barrieren gehen jedoch immer noch über die Sensibilität des Gesundheitspersonals und die Verfügbarkeit des Migranten für die Arzt-Patienten-Beziehung hinaus. Tatsächlich gibt es immer noch grobe strukturelle Barrieren, die leicht in der mangelnden Verfügbarkeit elementarer Instrumente bei der Behandlung von Patienten aus entfernten geografischen Gebieten nachvollzogen werden können. Beispielsweise ist die Nichtdefinition von Normalwerten für gemeinsame Bluttests in weiten Teilen Subsahara-Afrikas häufig; für diese Populationen werden immer noch spezifische Normalbereiche für kaukasische Populationen (die aus ihrer kolonialen Vergangenheit stammen) übernommen. In ähnlicher Weise wird auch heute noch ein großer Teil der klinischen Studien, die die Angemessenheit von Diagnoseinstrumenten oder die Wirksamkeit/Sicherheit von Medikamenten bewerten, hauptsächlich bei kaukasischen Patienten mit einer geringen Anzahl asiatischer und/oder afrikanischer Patienten durchgeführt. Diese Aspekte wirken sich stark auf die allgemeine Qualität der medizinischen Versorgung der Migrantenbevölkerung aus, vor allem aber auf die Ankunft, wenn nur noch sehr wenige Informationen verfügbar sind.
Weibliche Genitalverstümmelung stellt daher ein Thema dar, bei dem die Migrationsmedizin einen harten Test in Bezug auf das Management der Gesundheit von Migrantinnen gefunden hat. Tatsächlich ist dieser Schauplatz eines der Schlachtfelder, auf denen das zukünftige Vertrauen des Migranten in die Gesundheitseinrichtungen des Gastlandes ausgespielt wird.